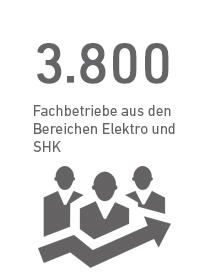Vorzeigepflicht des Energieausweises fürs Haus ab 2013
Seit 2008 gibt es für Häuser einen Energieausweis, an dem der Käufer oder Mieter eines Hauses oder einer Wohnung den Energiebedarf eines Bauwerks erkennt und nicht erst nach der ersten Heizperiode. Für Neubauten gab es diesen Energieausweis schon länger, denn die Energiesparverordnung fordert den rechnerischen Nachweis, dass die verwendete Bau- und Anlagentechnik zur Einhaltung der Grenzwerte der Energiesparverordnung führt. Einen Boom bei Energieausweisen gab es aber erst durch die Neuregelung für bestehende Gebäude, denn in Deutschland gibt es über 38 Millionen Wohneinheiten. Nach Schätzungen von Experten könnten in rund 2/3 dieser Gebäude durch energetische Modernisierung eine erhebliche Energieeinsparung erzielt werden.
Der Energieausweis fürs Haus - Pflicht ab 2013
Bereits seit 2008 ist ein Energieausweis für Eigentümer, die eine Immobilie verkaufen wollen, und für Vermieter Pflicht. Allerdings mussten sie diesen bisher nur auf Verlangen beim Verkauf oder der Vermietung von Wohneigentum vorlegen – das ändert sich ab 2013. Ziel der Einführung des Energieausweises im Rahmen der Energieeinsparverordnung war es, für mehr Energie-Transparenz zu sorgen, wenn eine Immobilie vermietet oder verkauft wird. Kauf- oder Mietinteressenten sehen damit auf den ersten Blick, welche Energiekosten auf sie zukommen. Ab 2013 verpflichtet die europäische Gesetzgebung dazu, den Energieausweis aktiv und nicht erst auf Verlangen vorzuzeigen.
Die neue Regelung setzt somit Hauseigentümer unter Druck, weil die energetischen Angaben sogar bereits bei Wohnungsanzeigen verpflichtend sein sollen. Entsprechend werden sich Immobilien mit geringer Energieeffizienz schwieriger verkaufen oder vermieten lassen als solche mit modernen Energiestandards. Dann können energetische Sanierungsmaßnahmen zu einem starken Verkaufsargument werden.
Die Richtlinie eröffnet vielen Unternehmen, die Energieberatung und Baumaßnahmen durchführen können, ein großes Geschäftsfeld.
Forderungen aus der EU-Richtlinie 2002/91/EG zum Gebäude Energiepass
• Die Erstellung von Energieausweisen wird auch für Bestandsbauten obligatorisch
• Der Gebäude Energiepass muss den Verbrauchern einen Vergleich und eine Beurteilung der Energieeffizienz des Gebäudes ermöglichen
• Dem Ausweis sind Empfehlungen zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz beizufügen
• Der Ausweis muss Referenz- und Vergleichswerte enthalten
• Die Erstellung des Energieausweises und der begleitenden Empfehlungen muss in unabhängiger Weise von qualifizierten und/oder zugelassenen Fachleuten durchgeführt werden
Aus diesen Forderungen ergeben sich Anforderungen an die Fachleute, die Untersuchungen für den Energiepass durchführen und an die Werkzeuge und Messgeräte, die hierfür erforderlich sind.
Thermografische Untersuchung von Häusern
Innerhalb der Messungen zum Energiepass kommt der Thermografie besondere Bedeutung zu, denn die Thermografie ist eine Möglichkeit, grundlegende Erkenntnisse über die Energieeffizienz eines Gebäudes und die energetischen Schwachstellen zu erhalten.
Wie funktionieren thermografische Messungen?
Wärme wird auf drei Arten übertragen: Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung. Thermografie macht Wärmestrahlung von Objekten – somit auch von Gebäuden – mittels einer speziellen Wärmebildkamera als Bilder sichtbar.
Auch die Wärme, die durch Wärmeleitung und Konvektion letztlich zur Außenhülle eines Gegenstandes (z. B. Gebäudes) gelangt, wird als infrarote Wärmestrahlung Endes in den Raum abgestrahlt. Thermografie basiert auf dem Verfahren der Abstrahlung langwelligen Infrarotlichtes jedes Körpers. Eine moderne Wärmebildkamera verfügt über ein Mikrobolometer, welches wie ein Bildsensor aufgebaut ist, dessen Pixel aber anstatt für sichtbares Licht auf Infrarotstrahlung ausgelegt sind. Die empfangene Strahlungsintensität wird zur Auswertung in ein Falschfarbenbild übersetzt, welches vom Anwender leicht interpretiert werden kann.
Wärmebildkameras sind technisch aufwendig und für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen konzipiert. In den letzten Jahren sind die Produktionszahlen allerdings deutlich gestiegen, und so sind robuste Einstiegsmodelle, die für Messungen in der Gebäudetechnik optimiert sind, schon ab 2.000 Euro erhältlich.
Wärmebildkameras bieten deutliche Anwendungsvorteile und liefern schnell und berührungslos Wärmebilder, mit denen kleine Temperaturunterschiede grafisch dargestellt werden.
Dadurch wird der Wärmeverlust von Gebäuden schnell sichtbar, denn man kann die Temperatur auf der Oberfläche eines Objekts und damit auch Wärmeverluste sichtbar machen. Bei der Betrachtung eines Hauses durch die "Brille" einer Wärmekamera werden Fehlstellen der Dämmung auch ohne zerstörende Materialuntersuchungen schnell offensichtlich. Häufige Wärmelecks sind Rolladenkästen, Steigleitungen, die Wand hinter Heizkörpern, Fenster und Türen, Dachfirste, usw. Nach erfolgtem Umbau bzw. Renovierung sollte man sich das Ganze zum Vergleich noch einmal anschauen und ggf. nachbessern. Durch die steigenden Energiekosten lohnen sich solche Umbauten eher früher als später.
Um von einem Haus thermografische Aufnahmen zu erstellen, um die Qualität der Wärmedämmung zu testen, ist der Winter - oder zumindest die kältere Jahreszeit – die richtige Jahreszeit, d. h. es sollten Differenzen zwischen der Temperatur in den Innenräumen und der Lufttemperatur außerhalb des Gebäudes von mindestens 10-20 °C herrschen. Außerdem sollte das Gebäude zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Nachts oder früh morgens, wenn die Restwärme etwaiger Sonneneinstrahlung nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt, herrschen die geeigneten Bedingungen. Hält man diese Randbedingungen nicht ein, erhält man zwar schöne bunte Aufnahmen - aber keine, in denen die tatsächlichen Wärmebrücken sichtbar sind.
Moderne Wärmebildkameras sind einfach zu handhaben, und der Thermograf kann relativ schnell arbeiten: Kamera auspacken, einschalten und ein paar Bilder schießen. Die Auswertung der Bilder und die Dokumentation werden durch die maßgeschneiderte Software deutlich vereinfacht.
Wärmebildkameras sind für die Diagnose folgender Probleme an Gebäuden besonders geeignet:
• Steigerung von Wärmewirkungsgrad von Wohn- und Geschäftsgebäuden, durch Ermittlung von Dichtigkeit, Heizungs- und Belüftungsproblemen
• Lokalisierung von mangelhafter Isolation, eindringendem Wasser sowie Feuchtigkeits- und Belüftungsproblemen
• Erkennen von typischen Wassersammelstellen auf Flachdächern, die dann repariert oder ausgetauscht werden können
• Schnelle und exakte Lokalisierung von potentiellen Feuchtigkeitsherden in Innenwänden, Zimmerdecken oder Fußböden
Zur Dokumentation dient die Software SmartView zur Bearbeitung der Wärmebilder. Hiermit können am PC folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden.
• Einfaches Erstellen benutzerdefinierter, professioneller Berichte
• Bildübertragung und Bildspeicherung
• Bildansicht mit 10 Farbpaletten
• Parametereinstellung: Emissivität und Hintergrundtemperatur
Wärmebildkameras für thermografische Messungen an Gebäuden
Ein Beispiel für speziell für die Gebäudediagnose entwickelten Wärmebildkameras sind die verbreiteten Modelle Fluke TiR und TiR1. Diese preisgünstigen und professionellen Modelle sind intuitiv und selbst für Thermografie-Neulinge einfach zu bedienen. Man muss nur die Kamera auf die gewünschte Stelle richten, scharf stellen und das Bild aufnehmen. Wie fast alle Fluke-Wärmebildkameras verfügen sie über die IR-Fusion®-Technologie. Obwohl Infrarot-Thermografie Temperaturunterschiede klar hervorhebt, ist die Interpretation reiner Wärmebilder nicht immer einfach. Betroffene Stellen können schwierig anzuvisieren sein – z. B. eine kalte Stelle irgendwo in einer Wand, oder eine feuchte Stelle in einem großen Dach. Die Fluke IR-Fusion®- Technologie löst dieses Problem durch Einblendung des Wärmebilds in ein detailliertes Sichtbild. Somit kann man kritische Stellen, die man im Wärmebild sieht, exakt räumlich einordnen. Durch die optimierte thermische Empfindlichkeit (NETD = Noise Equivalent Temperature Difference) kann man selbst geringste Temperaturunterschiede identifizieren. Dies ist besonders bei der Gebäudediagnose wichtig, wo ein kleiner Unterschied ein potenziell großes Problem anzeigen kann.
Fazit:
Fluke Wärmebildkameras eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zur Erstellung des Gebäude Energiepasses und als wertvolles Werkzeug zur Ermittlung von Schaubildern und Messwerten für Begutachtungen und Energieberatungen. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der weiter steigenden Nachfragen nach Energiepässen, Beratungen und Begutachtungen ist zu erwarten, dass sich Investitionen in diese Technik schnell amortisieren werden.
Jetzt Fluke Wärmebildkameras kostenlos 2 Tage testen
Der kostenlose 2-Tage Test wird professionellen Anwendern aus dem Bereich Gebäudediagnose und Gebäudeinstandhaltung sowie der Industrie- und Elektrobranche angeboten, die eine Fluke-Wärmebildkamera ausprobieren oder kennenlernen möchten, um Vorteile für ihre tägliche Arbeit in der Praxis zu erfahren.
Jetzt anmelden unter: <link http: www.fluke.de try _blank external-link-new-window>www.fluke.de/try